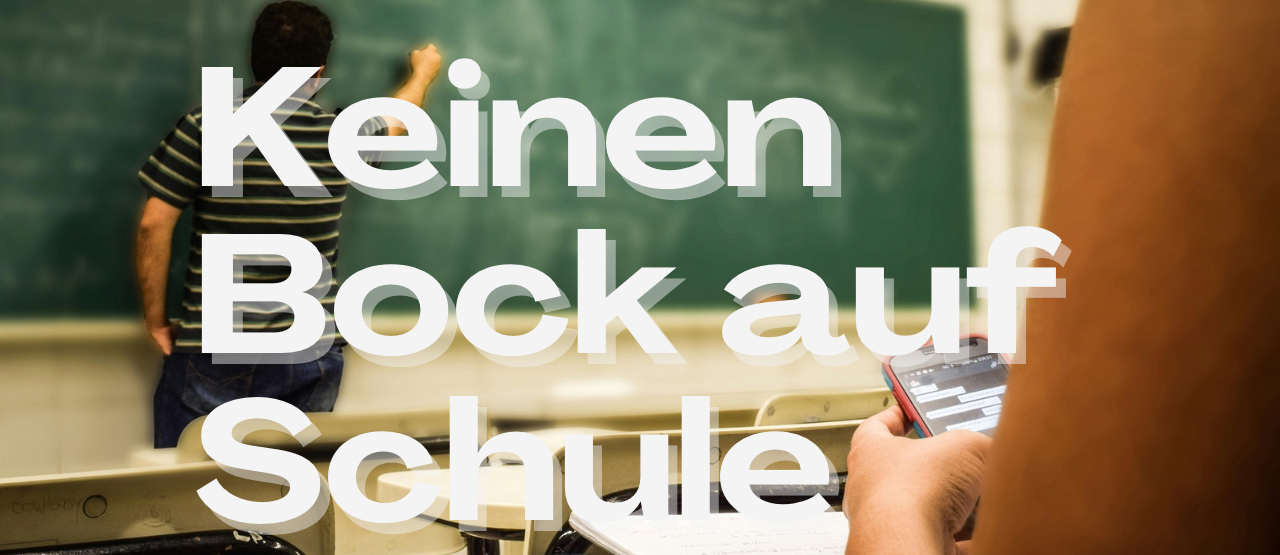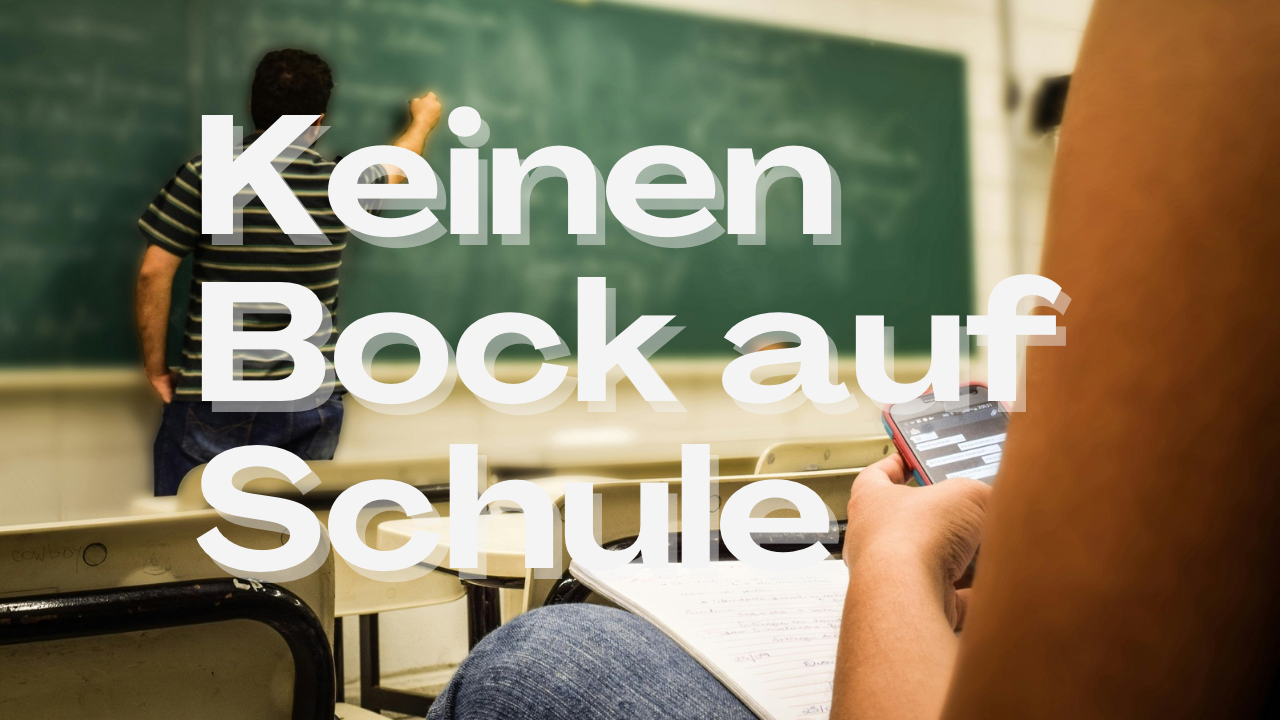Die Frankfurter Rundschau hat am 19.03.2025 unter diesem Titel ein Interview mit Josef Kraus über ein kaputtes Bildungssystem veröffentlicht.
Ganz am Ende lesen Sie meinen Kommentar dazu.
„Bildung in Deutschland ist nicht mehr das, was sie mal war“, sagt Josef Kraus im Interview. Der langjährige Lehrerpräsident sieht die Probleme auch im „Pisa-Schwindel“.
Josef Kraus war 30 Jahre lang Präsident des Deutschen Lehrerverbands. Er weiß um die Fehler im deutschen Bildungssystem und sagt im Gespräch mit der Frankfurter Rundschau: „Die Ansprüche sind stark gesunken.“ Das hänge auch mit falschen Schlüssen aus den Pisa-Studien zusammen. „Manche sind geradezu besoffen von Pisa-Ergebnissen“, sagt Kraus, der gerne auch vom „Pisa-Schwindel“ spricht und bei Jugendlichen einen „geografischen und historischen Analphabetismus“ beobachtet. Was meint er damit?
Früherer Lehrerpräsident im Interview: „Haben unser Bildungssystem selbst kaputt gemacht“
Herr Kraus, wie blicken Sie auf das deutsche Bildungssystem?
Bildung in Deutschland ist nicht mehr das, was sie mal war. Früher war „Qualified in Germany“ ein Aushängeschild. Heute haben wir unser Bildungssystem selbst kaputt gemacht.
Wie das?
Wir haben zum Beispiel das weltweit hoch angesehene Diplom weggeworfen. Man wollte außerdem mehr Abiturienten und Studenten. Das hat die berufliche Bildung ausgedünnt und mit Bachelor und Co. zu einer Pseudoakademisierung geführt. Die Ansprüche wurden heruntergefahren, denn niedrigere Ansprüche bedeuten mehr Abiturienten. Selbst in Bayern gibt es Abidurchschnittswerte von 2,2 – an einigen Gymnasien gar 1,9. Früher war das ein Spitzenabitur, und der rechnerische Durchschnitt lag bei 2,6 bis 2,8.
Dass Schüler heutzutage bessere Noten erzielen, ist schlecht?
Es ist nicht vergleichbar. Die Ansprüche sind stark gesunken. Man kann nicht sagen, dass die Schüler einfach besser geworden sind. Mit den guten Noten wird ihnen vorgegaukelt, dass sie mehr drauf hätten, als sie es wirklich haben. Zeugnisse sind damit zum Teil ungedeckte Schecks.
Dumme Jugendliche? Lehrerpräsident sieht „geografischen und historischen Analphabetismus“
Inwiefern sind die Ansprüche denn gesunken?
Im Lehrplan werden bestimmte Themen wie etwa geschichtliche Ereignisse weniger detailliert behandelt. Konkretes Wissen scheint hier „out“ zu sein. Außerdem gab es Änderungen bei den Prüfungsverfahren. Früher zählten die schriftlichen Leistungen mehr, jetzt sind sie gleichberechtigt mit den mündlichen. Die mündlichen Leistungen sind aber immer besser als die schriftlichen. Ein weiterer Grund für den Verfall des Bildungssystems ist die sogenannte empirische Wende.
Was meinen Sie damit?
Eine Testeritis hat Einzug gehalten. Siehe etwa die Pisa-Tests. Der sogenannte Pisa-Schock im Jahr 2000/2001 hat dazu geführt, dass man viele Bereiche im Lehrplan weniger wertgeschätzt hat. Und zwar jene Bereiche, die nicht messbar sind. Pisa misst schließlich nur Ausschnitte aus den Bereichen Lesekompetenz, Mathematik- und naturwissenschaftliches Verständnis.
Was fehlt in den Pisa-Erhebungen?
Fremdsprachen, literarisches Wissen, Kreativität sowie kulturelles, geografisches, historisches und politisches Wissen. Diese Bereiche wurden im Lehrplan kontinuierlich abgespeckt. Folge: Wir sehen heutzutage bei Jugendlichen einen unglaublichen geografischen und historischen Analphabetismus. Fragen Sie mal junge Menschen nach den Landeshauptstädten und Regierungen der Bundesländer. Sie werden von den Antworten schockiert sein.
„Wir müssen und dürfen unseren Kindern wieder mehr abverlangen“
Sie haben in einem Buch mal vom „Pisa-Schwindel“ geschrieben. Untertitel: „Unsere Schüler sind besser als ihr Ruf.“ Würden Sie das heute wieder so formulieren?
Heute würde ich das ein bisschen anders formulieren. Unsere Kinder könnten mehr, als man von ihnen verlangt. Wir sollten unseren jungen Leuten wieder mehr zutrauen und letztendlich auch mehr zumuten. Aber: Pisa ist kein Bildungstest; trotzdem sind manche geradezu besoffen von Pisa-Ergebnissen. Deshalb „Schwindel“!
Warum?
Weil Äpfel mit Birnen verglichen wurden. Finnland galt als das Aushängeschild der Bildung, sie hätten 60 bis 70 Prozent Studentenquote. Da müsse Deutschland auch hin, hieß es Anfang der 2000er oft. Was vergessen wurde: In Finnland hat auch der Krankenpfleger oder die Kindergartenerzieherin einen Hochschulstempel.
Wie kann das deutsche Bildungssystem wieder besser werden?
Junge Menschen und deren Eltern haben das Gefühl, eine berufliche Bildung sei nichts wert. Wir müssen deshalb diesen Bereich wieder stärken. Die Meisterprüfung sollte über der Ebene eines Uni-Bachelors angesiedelt sein. Dann müssen die Ansprüche strenger werden. Bayern ist das einzige Bundesland, das nach der Grundschule gewisse Kriterien für den Übertritt aufs Gymnasium hat. Andernorts kann jeder aufs Gymnasium gehen.
Und, wo wir schon bei Ansprüchen sind: Die Lehrpläne müssen anspruchsvoller werden. Wir müssen und dürfen unseren Kindern wieder mehr abverlangen. Je weniger Menschen konkretes, historisches und geschichtliches Wissen haben, desto eher müssen sie sich von irgendwelchen Scharlatanen oder Gurus etwas vormachen lassen.
Welche Scharlatane oder Gurus?
Große Teile der Politik und der Medien. Blicken wir auf die aktuelle Abstimmung zum Billionen-Sondervermögen. 98 Prozent der Schüler verstehen das doch gar nicht. Die wissen nichts von der Zusammensetzung im Bundesrat oder von der nötigen Zweidrittelmehrheit. Politikern ist das natürlich egal, denn – nach George Orwell – Unwissenheit ist Stärke. Ein dummes Volk regiert sich leichter.
Ihr Ernst? Das klingt so, als ob die Bildungsmisere politisch gewollt sei.
Man nimmt es zumindest gerne in Kauf. In meinem neuen Buch greife ich das auf. Ein Volk regiert sich am leichtesten mit zwei Methoden. Erstens: dass man Bildung und Informationen vorenthält. Und zweitens: mit Angst machen. Angst vor Krieg, vor Corona, vor der Klimakatastrophe und so weiter.
In jenem Buch – „Im Rausch der Dekadenz“ – beschreiben Sie Universitäten als „Wokeness-Fabriken“. Ist das nicht etwas übertrieben?
Das ist kein Urteil über alle 400 Hochschulen und alle Fakultäten. Aber für bestimmte Fachbereiche und bestimmte Hochschulen, zum Beispiel Frankfurt oder Berlin, gilt das sehr wohl. Dort bekommen Professoren Redeverbot, wenn sie Studenten statt Studierende oder Student*innen sagen. Und die Gender-Ideologie wird mancherorts schon als Ersatzreligion verstanden. Für Gender- und „diversity“-Studies und Co. gibt es zudem mehrere hundert Professuren. Wer eigentlich braucht Absolventen solcher Studiengänge?
Unterricht und Migration: „Schulsystem ist mit der Zuwanderungspolitik restlos überfordert“
Lassen Sie uns zurück zur Bildungspolitik kommen. Verstehe ich Sie richtig, dass Sie keine grundlegenden Veränderungen wollen – das Schulsystem aus Gesamtschule, Realschule, Gymnasium sollte bleiben?
Absolut. Die Strukturfummeleien bringen nichts.
In anderen Ländern funktioniert es gar nicht so schlecht. In Portugal, Island oder Finnland gehen die Schüler teils bis zur 10. Klasse auf dieselbe Schule. Das kann durchaus klappen.
Ist es da wirklich besser?
Laut Pisa schon, ja.
Ja, aber wie schon angeführt, Pisa kann kein Maßstab sein. Die genannten Länder sind auch deshalb nicht vergleichbar, weil sie nicht den hohen Migrationsanteil haben, der das deutsche Schulsystem zusätzlich herausfordert. Wir haben in den Grundschulen aktuell 55 bis über 60 Prozent Migrationsanteil. Und da hapert es in vielen Bereichen.
Wie verändert Migration das Bildungssystem?
Das deutsche Schulsystem ist mit der großzügigen Zuwanderungspolitik der letzten Jahre restlos überfordert. Auch wegen hoher Migrantenanteile müssen die Ansprüche heruntergefahren werden. Eine pensionierte Grundschulrektorin aus Frankfurt sagte mir: Was wir früher in der zweiten Klasse verlangt haben, können wir heute erst in der vierten voraussetzen.
Wie kann man gegensteuern?
Vor der Einschulung sollte ein Sprachstandstest gemacht werden. Wenn ein Kind diesen Test nicht besteht, muss es ein Jahr lang eine Sprachlernklasse besuchen. In Ballungsgebieten sprechen in den Grundschulen immer weniger Schüler Deutsch. Auch, weil viele Migrantenfamilien zu Hause kaum Deutsch sprechen.
Sind die Klassen mittlerweile zu groß?
Bei Klassen mit einem hohen multikulturellen Anteil sind 20 oder 25 Kinder zu viel. Nur: Wir haben gar nicht die Lehrer, um die Klassen kleiner zu machen. Der Lehrermangel ist das nächste Thema, das die Politik verschlafen hat.
Ist es wirklich so ernst?
Ja. Der Lehrermangel wird die nächsten zehn, zwölf Jahre noch eklatanter werden, weil starke Jahrgänge in Rente gehen und die Schülerzahl nicht weniger wird; auch aufgrund der Zuwanderung.
Wie hat sich generell der Beruf des Lehrers verändert?
Aufgrund einer veränderten Schülerschaft sind die Herausforderungen heute andere als früher. Schüler sind mitunter verwöhnt durch Helikoptereltern, die Lehrern bei einer Note 3 für ihr Kind mit einem Anwalt drohen. Außerdem sind die jungen Leute heute immer weniger konzentriert, was meiner Meinung nach an den neuen Medien liegt.
Kurz vor der Bildungsministerkonferenz gibt es Diskussionen um den Umgang mit digitalen Medien. Sollten Handys und Tablets im Unterricht benutzt werden dürfen?
Nein, ich bin für ein strenges Verbot von Smartphones. Und ich bin auch dagegen, dass vor der 5. oder 6. Klasse Laptops im Unterricht eingesetzt werden.
Haben Schüler heutzutage noch Respekt vor Lehrern?
Ja und nein, es hängt letztendlich auch von der Lehrerschaft ab. Eine Lehrerschaft, die auf Augenhöhe und Kumpanei macht, muss sich viel gefallen lassen. Schüler und Lehrer können nicht auf einer Augenhöhe sein. Es braucht eine natürliche Autorität.
Interview: Andreas Schmid
Mein Kommentar
Kraus nennt die Dinge beim Namen. Leider werden viele Aspekte nicht tiefgründig betrachtet, so z. B. die Entkernung der Lehrpläne, die interessanterweise Kernlehrpläne heißen oder die freie Schulwahl – allein der Elternwille zählt. Ebenso fehlt eine genauere Betrachtung der Gründe, die Kraus dazu veranlassen, das dreigliedrige Schulsystem hochzuhalten.
Ich halte das fehlende Wissen gerade in den Gesellschaftswissenschaften ebenfalls für fatal, Kraus beschreibt das recht gut. Aber auch im naturwissenschaftlichen Bereich steht die Phänomenologie im Mittelpunkt, u. a. getrieben von den Ideen der Energiewende.
Schüler müssen heute keine Gedichte mehr auswendig lernen oder wohlmöglich sogar ein Diktat schreiben. Neumodischer Kram ersetzt die Literatur, die ich persönlich als großes kulturelles Erbe betrachte: Goethe, Schiller, Mann, aber auch die großartigen nichtdeutschen Schriftsteller.
Übrigens werden Lehrer (in meinem Haus wird keiner wegen des generischen Maskulinums angezählt) heutzutage ganz anders ausgebildet. Kooperative Lernformen und Checklisten sind allgegenwärtig, Frontalunterricht ist verpönt.
Je weniger Menschen konkretes, historisches und geschichtliches Wissen haben, desto eher müssen sie sich von irgendwelchen Scharlatanen oder Gurus etwas vormachen lassen.
Welche Scharlatane oder Gurus?
Diese Frage kann nur von einem „Mainstream-Journalisten“ kommen… Andreas Schmid tut hier so, als käme er von einem anderen Planeten, die Art der Fragestellung ist schon recht seltsam.
Was den Respekt vor Lehrern angeht, verweise ich auf meine Artikel zur professionellen Distanz (hier und hier).
Views: 20