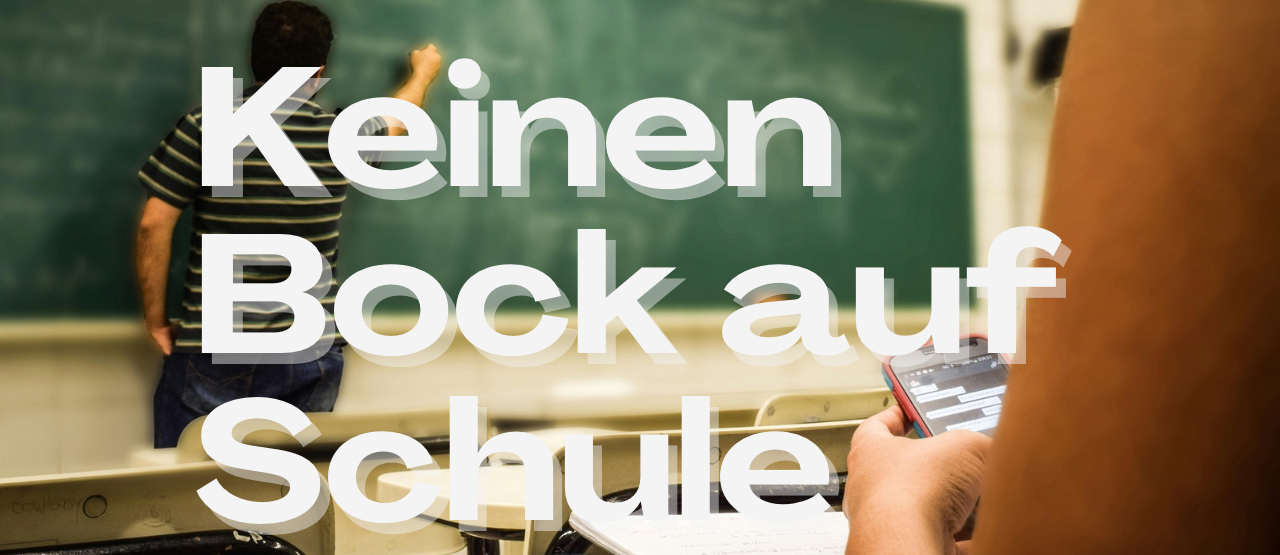Ist die Schule die Quelle der Meinungsfreiheit oder der Beginn der Propaganda? Diese Frage ist bedeutsamer als sie scheint.
Wilhelm von Humboldt formulierte ausgangs des 18. Jahrhunderts sein Bildungsideal:
Es gibt schlechterdings gewisse Kenntnisse, die allgemein sein müssen, und noch mehr eine gewisse Bildung der Gesinnungen und des Charakters, die keinem fehlen darf. Jeder ist offenbar nur dann ein guter Handwerker, Kaufmann, Soldat und Geschäftsmann, wenn er an sich und ohne Hinsicht auf seinen besonderen Beruf ein guter, anständiger, seinem Stande nach aufgeklärter Mensch und Bürger ist. Gibt ihm der Schulunterricht, was hierfür erforderlich ist, so erwirbt er die besondere Fähigkeit seines Berufs nachher so leicht und behält immer die Freiheit, wie im Leben so oft geschieht, von einem zum andern überzugehen.
P. Berglar (1970): Wilhelm von Humboldt, p. 87
Die zentralen Aspekte sind Allgemeinbildung und Aufklärung, letztere als Rückgriff auf Immanuel Kants Ausschärfung des fast schon berühmten „Sapere aude!“, was auf den römischen Dichter Horaz zurückgeht. Nach Humboldt bestehe die Hauptaufgabe der Schule darin, allgemeingebildete und mündige Menschen hervorzubringen. Lesen Sie dazu auch meinen Beitrag zu Kant und Humboldt.
Schulbücher
Ich kann es nicht besser formulieren, als der Autor dieses Artikels:
https://www.freie-medienakademie.de/medien-plus/103
Ich habe Hauke Arachs Buch gelesen und pflichte dem Geschriebenen nahezu vollständig bei.
Die Kritik an unserem Schulsystem hat in den letzten Jahren an Fahrt aufgenommen, immer mehr Eltern wollen ihre Kinder diesem System nicht mehr bedingungslos aussetzen und starten Initiativen zur Gründung von Privatschulen. Wissenschaft, so die Kritik, werde nicht mehr als Diskurs vermittelt, sondern als eine nicht zu hinterfragende Wahrheitsverkündung. Der Autor ist seit Jahren an der pädagogischen Front und zeigt an konkreten Beispielen aus Schulbüchern zu Geschichte, Biologie, Erdkunde und Politik, was unsere Jugend nach den Vorstellungen der Bildungspolitik lernen soll, und, vor allem, was ihr vorenthalten wird.
Text auf dem Bucheinband
Interessant ist auch folgendes Interview:
Die Antwort auf die letzte Frage „Was müsste Ihrer Meinung nach an deutschen Schulen bzw. im deutschen Bildungssystem verändert werden? Und wie könnte dies erreicht werden?“ fasst den Kern des Interviews gut zusammen:
Das Wichtigste wäre, dass sich die Behörden aus der inhaltlichen Gestaltung des Unterrichts heraushalten. Mit Lehrplänen, Curricula und Schulbuchzulassungen regieren die Behörden tief in den Unterricht hinein. Zu Beginn meiner Dienstzeit sprach man von der „pädagogischen Verantwortung des Lehrers“. Das ist vorbei. Im Beutelsbacher Konsens von 1977 verboten die Kultusministerien jede Art von Indoktrination. Heute haben wir de facto das Gegenteil. Der erste Schritt zu einer besseren Schule wäre, das Problem in seiner Dimension überhaupt erst einmal zu sehen. Dazu möchte ich mit meinem Buch einen Beitrag leisten. Wobei ich mir bewusst bin: Solche Bewusstseinsveränderungen sind ein sehr langwieriger Prozess.
Meinung der Lehrer zu bestimmten Themen
Der Beutelsbacher Konsens ist die Grundlage für politisch-historische Bildung in den Schulen. Die Kernaussagen lauten wie folgt:
Es ist nicht erlaubt, den Schüler – mit welchen Mitteln auch immer – im Sinne erwünschter Meinungen zu überrumpeln und damit an der „Gewinnung eines selbständigen Urteils“ zu hindern.
https://www.lpb-bw.de/beutelsbacher-konsens
Was in Wissenschaft und Politik kontrovers ist, muss auch im Unterricht kontrovers erscheinen. Diese Forderung ist mit der vorgenannten aufs engste verknüpft, denn wenn unterschiedliche Standpunkte unter den Tisch fallen, Optionen unterschlagen werden, Alternativen unerörtert bleiben, ist der Weg zur Indoktrination beschritten.
ebenda
Der Schüler muss in die Lage versetzt werden, eine politische Situation und seine eigene Interessenlage zu analysieren, sowie nach Mitteln und Wegen zu suchen, die vorgefundene politische Lage im Sinne seiner Interessen zu beeinflussen.
ebenda
So weit, so gut. Die Schulgesetze und Rahmenbedingungen, die eine Umsetzung des Bildungsideals ermöglichen, sind da und sind wirklich gut. Nur leider hapert es an der Umsetzung.
Wo beginnt Überrumpelung? Lehrer sind keine neutralen Wesen von einem anderen Planeten. Sind sie so gut ausgebildet, dass sie unabhängig von ihrer eigenen Meinung Sachverhalte neutral und ausgewogen darstellen können, noch dazu vor dem Hintergrund dessen, was ich im vorigen Kapitel erläutert habe?
Wenn man sich die genannten Kontroversen in Wissenschaft und Politik genauer betrachtet, dann kommt man recht schnell zu dem Schluss, dass es diese gar nicht mehr wirklich gibt. Denken Sie an die Corona-Zeit. „Corona-Leugner“ oder „Impfgegner“ sind meiner Ansicht nach nicht das, was man als ergebnisoffene Diskussion erwartet. Ein andere Beispiel ist der Umgang mit Russland im aktuellen Konflikt mit der Ukraine. Ich möchte nicht weiter darauf eingehen, weiter ähnliche Beispiel lassen sich finden, wenn man bereit ist, andere Standpunkte überhaupt zuzulassen.
Das derzeit deutlichste Beispiel dafür, dass echte Kontroversen gar nicht erwünscht scheinen, ist der politische und gesellschaftliche Umgang mit der AfD. Bei aller Kritik hat die grundsätzliche Ablehnung für mich nichts mit Diskurs zu tun.
Ich sehe mit Sorge, dass die politische Mitte nicht nur, aber mehr noch im Osten unseres Landes an Rückhalt eingebüßt hat, und das in einer Zeit, in der unsere Demokratie insgesamt stärker denn je angefochten ist. Heute erleben wir auch in unserem Land, dass politische Kräfte Wahlerfolge feiern, die die Demokratie geringschätzen, ihre Institutionen verachten und aushöhlen wollen, die mit Hass und Hetze die für die Demokratie so überlebenswichtige Debatte vergiften, die Menschenfeindlichkeit verbreiten.
https://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Frank-Walter-Steinmeier/Reden/2025/10/251001-OV-TdDE.html
Wen meint er hier wohl, ohne explizit einen Namen zu nennen? Warum beschimpft er die Menschen im Osten, wo er doch vorher in seiner Rede die Leistungen der Menschen in der ehemaligen DDR so hoch gelobt hat? Was hat er in Bezug auf „Wahlerfolge“ nicht verstanden? Menschen wählen zuweilen anders, als es dem einen oder anderen passt. Ist es nicht der Kern der Demokratie, dass Volkes Stimme entscheidet? Ist die Kritik an der Vergiftung der Debatte nicht selbst ein Gift? Fragen über Fragen… Aber allein, dass ich diese so hier stelle, kann heute schnell dazu führen, dass auch ich – wie heißt es doch so schön – gecancelt werde. Vielleicht sind die Ostdeutschen aufgrund der Erfahrung mit einer Diktatur einfach sensibler im Erkennen von totalitären Elementen.
Zurück zur Schule: Wer legt eigentlich fest, was kontrovers bedeutet? Es ist vor allem dann schwierig, wenn viele Menschen zunehmend den Eindruck haben, ihre Meinung nicht mehr ungestraft sagen zu können. Wie sollen unsere Schüler so in die Lage versetzt werden, eine politische Situation zu analysieren?
Umgang mit der AfD
Ich habe es gerade angesprochen. Ein besonders herausstehendes Problem unserer Debatten(un)kultur ist der Umgang mit der AfD. Nun möchte ich mich an dieser Stelle nicht ausführlich damit beschäftigen, wer was und wann mal gesagt haben soll, was angeblich oder eindeutig der Sprechweise des Dritten Reiches entspringt. Vielmehr geht es mir darum, zu hinterfragen, wie wir als Lehrer mit der Gesamtsituation umgehen müssen.
Keine andere Partei polarisiert so sehr, wie die AfD. Von „Brandmauer“ bis „Omas gegen Rechts“ gibt es wohl keine andere politische Kraft, der soviel Wind entgegenweht.
Der Spagat, den Lehrer hinbekommen müssen – so meine Ansicht – ist der, dass, solange die Partei auf den Wahlzetteln auftaucht, diese in der Schule auch als Teil des Parteienspektrums neutral dargestellt werden sollte. Gelingt das? Meine Erfahrungen aus Gesprächen mit Lehrerinnen und Lehrern sind andere. Wie neutral kann man sein, wenn man innerlich diese Partei nicht nur ablehnt (was ja völlig in Ordnung ist), sonder abgrundtief hasst. Ja, ich benutze dieses Wort ausnahmsweise, obwohl es gesellschaftlich verbrannt ist. Hass ist ein Gefühl und darf meinen Unterricht nicht beeinflussen, siehe o. g. Überrumpelung. Allerdings wird hier mit einem anderen Maß gemessen, wenn sich sogar die Bildungsministerin nicht zu schade ist, zu Demonstrationen gegen Rechts aufzurufen. Soviel zur Neutralität. Die Brandmauer existiert nicht nur in den Parlamenten, sondern auch in den Köpfen vieler Menschen. Ich muss mit dem, was die Vertreter der AfD – und das gilt letztlich für alle Parteien – von sich geben, nicht einverstanden sein, muss es aber als Meinung (auch wenn sie zuweilen grenzwertig erscheint) akzeptieren. Brandmauern und Unvereinbarkeitsbeschlüsse (was die Linken angeht) sind mit Demokratie unvereinbar.
Nur in der Debatte – und zwar ohne Einschränkungen – kann man Politiker stellen. Aus Prinzip mit anderen nicht zu diskutieren, zeigt für mich ein etwas seltsames Demokratieverständnis. Bis zu 40 % der Menschen im Osten der Republik tendieren zur AfD, Umfragen und Wahlergebnisse zeigen das sehr deutlich. Haben all diese Menschen ihr Recht auf Teilhabe an der Demokratie und am Diskurs verwirkt? Statt sie zu diffamieren (Steinmeier, s. o.) sollte man ihnen zuhören und die Probleme angehen, statt nur heiße Luft zu produzieren. Die Wahrnehmung dessen, was Menschen als Probleme sehen, hat manchmal mit Fakten wenig zu tun. Das spielt aber keine Rolle. Auch gefühlte Probleme sind Probleme. Wenn es Parteien gelingt, bestimmte Themen groß zu machen, liegt das sicher einerseits an einer professionellen medialen Präsenz, aber andererseits auch daran, dass diese Themen auf fruchtbaren Boden treffen. Wo keine Probleme sind, kann sie auch niemand „ausschlachten“.
Aber zurück zum Thema: Der Umgang mit der AfD zeigt, wie fragil eine Demokratie sein kann. Für den Kampf gegen bestimmte politische Kräfte sind so manche „Demokraten“ bereit, die Demokratie zu gefährden. Auch Lehrer machen sich da mitschuldig.
Förderung eines kritischen Umgangs mit Politik und Gesellschaft
„Das ist ein weites Feld.“, hätte Effi Briests Vater wohl gesagt. Übrigens hat Günther Grass einen gleichnamigen Roman über die deutsche Einheit geschrieben. Genug klug ge…
Ich bin der Meinung, dass die Fähigkeit zum kritischen Umgang mit Politik, Gesellschaft und den zugehörigen Protagonisten mehrerer Grundlagen bedarf.
- Die Basis der Basis sind das sinnentnehmende Lesen und Hören. Es ist schlicht nicht möglich, schriftliche Beiträge (z. B. in Zeitungen oder Online-Medien) zu erfassen oder an Diskussionen teilzunehmen, wenn diese beiden Grundlagen nicht oder nur teilweise existieren.
- Ein zweiter Aspekt sind Materialien (Bücher, Lehrwerke im Allgemeinen, etwas weiter gefasst auch die Lehrpläne), die frei von Einflussnahme sind.
- Der entscheidende Punkt sind die Lehrer mit ihrer Ausbildung und dem Umgang mit den Inhalten des Beutelsbacher Konsens.
zu 1:
Im Lesen wird der Mindeststandard für den MSA bundesweit von 32,5 Prozent der Neuntklässlerinnen und Neuntklässler nicht erreicht (ESA 15,2 Prozent). […] Den Optimalstandard im Lesen erreichen bundesweit knapp 3,9 Prozent, […]
Anm.: MSA = mittlerer Schulabschluss, ESA = erster Schulabschluss
https://deutsches-schulportal.de/bildungswesen/iqb-bildungstrend-die-wichtigsten-ergebnisse/
Beim Zuhören liegen die Werte ähnlich.
Ich empfehle, den kompletten Bericht zu lesen, da auch Mathematik und Englisch sowie weitere Aspekte untersucht wurden.
zu 2:
Dazu habe ich mich weiter oben schon geäußert. Der Einfluss der Politik auf die Inhalte des Lehrplans oder die Bücher ist offensichtlich, da beides durch das Schulministerium abgesegnet werden muss. Lehrer haben eben keine komplett freie Auswahl, welches Buch sie benutzen oder wie sie bestimmte Themen inhaltlich gestalten. Es gibt im kleinen Rahmen Gestaltungsmöglichkeiten, aber die Eckpfeiler sind gesetzt. Zum Thema Kompetenzorientierung möchte ich mich hier nicht weiter äußern.
zu 3:
Das ist der eigentliche Dreh- und Angelpunkt. Die zentrale Rolle spielt der Lehrer, dazu braucht man auch keinen John Hattie.
Ergänzend zum oben bereits Gesagtem: Sind die Lehrer gut genug ausgebildet, um diesem Anspruch gerecht zu werden? Sind die Ausbildungspläne der Universitäten frei von Einflussnahme? Haben alle Lehrer die Größe und Souveränität, ihre eigenen Standpunkte zugunsten einer offenen und freien Meinungsbildung ihrer Schüler zurückzustellen?
Ich habe da meine Zweifel… Denn – ich zitiere mich selbst – Lehrer sind keine neutralen Wesen von einem anderen Planeten und haben selbst dieses Schul- und Hochschulsystem durchlaufen. Da kommt mir der Gedanke der selbsterfüllenden Prophezeiung in den Sinn.
Juniorwahl
Die Juniorwahl ist ein handlungsorientiertes Konzept zur politischen Bildung an weiterführenden Schulen und möchte das Erleben und Erlernen von Demokratie ermöglichen. Im Rahmen von Landtags-, Bundestags- und Europawahlen werden Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler von uns dabei unterstützt, eine realitätsgetreue Wahlsimulation an ihrer Schule zu organisieren und durchzuführen. Wir stellen didaktisches Unterrichtsmaterial zur Vorbereitung der Wahl sowie alle Wahlunterlagen und –materialien zur Verfügung, die für die Juniorwahl nötig sind.
https://www.juniorwahl.de/projekt/konzept
So weit, so gut. Wie bereits geschrieben: Die Schulgesetze und viele weitere Angebote sind gut und richtig.
Betrachten wir das Ergebnis zur Bundestagswahl 2025:

Mehr Statistiken finden Sie bei Statista
Stellen wir das Ergebnis der Wahl dagegen:

Mehr Statistiken finden Sie bei Statista
*Ironie on* Was haben wir in der Schule falsch gemacht, dreimal mehr „Die Linke“, die CDU fast halbiert? Glücklicherweise wählen Jugendliche weniger AfD… *Ironie off*
Allerdings zeigt der Vergleich zu 2021 deutlich, dass sich die Jugendlichen von den selbsternannten Parteien der demokratischen Mitte hin zu den sogenannten Rändern bewegen.

Mehr Statistiken finden Sie bei Statista
Verfängt unsere politische Bildung in den Schulen nicht mehr oder gibt es hier andere Gründe?
Ich glaube, dass Jugendliche in vielerlei Hinsicht leicht zu beeinflussen sind. Da gibt es „hippe“ Internetauftritte der Linken oder Clips in einfacher, verständlicher Sprache bei der AfD. Das ist, bevor ich falsch verstanden werde, absolut legitim. Die anderen Parteien versuchen auch, medial die Jugendlichen zu erreichen, vielleicht gelingt es ihnen nur nicht so gut.
Da wären auch noch Elternhäuser oder Freunde. Hinzu kommt, dass Jugendliche mit 16 Jahren noch gar keinen gefestigten politischen Standpunkt haben können. Wie auch, bei der geringen Lebenserfahrung. Frage am Rande: Warum dürfen 16-jährige wählen gehen?
Insofern ist alles erklärbar. Dass es nun gerade die Parteien ganz links oder rechts sind, die enorme Zuwächse haben, ist entweder Zufall (die nächste Juniorwahl wird es zeigen) oder selbst unsere jungen Leute nehmen mittlerweile wahr, dass die „etablierten“ Parteien keine Antworten mehr auf die Zukunftsfragen unserer nachwachsenden Generation haben.
Wo können wir als Schule ansetzen?
Bildung, Bildung und nochmal Bildung.
Wir müssen die deutsche Geschichte vollständig und ohne Rücksicht behandeln und erörtern. Wie konnte der Nationalsozialismus an die Macht geraten? Welche Fehler wurden ausgangs der Weimarer Republik gemacht. Wieso ist unser Grundgesetz deutlich „robuster“? Wieso haben wir eigentlich immer noch ein Grundgesetz und keine Verfassung? Warum sind voreilige Beschimpfungen von Menschen als Nazi Geschichtsklitterung? Wie haben die Menschen in der DDR gelebt? Ich könnte die Reihe beliebig fortsetzen.
Wir können vorurteilsfrei die Parteiprogramme besprechen, vielleicht auch Videos oder Reels ansehen und besprechen. Wir müssen unsere Kinder dazu erziehen, dass sie selbständig denken und nicht alles einfach glauben, was man ihnen sagt. Nur eines dürfen wir Lehrer nicht: Den Kindern weismachen, dass ihre Meinung falsch ist, auch wenn wir selbst einer anderen Überzeugung sind.
Das, was mittlerweile beobachtbar ist, nämlich die Verengung des Debattenraumes oder die Ablehnung des Diskurses mit bestimmtem Menschen, darf in der Schule nicht Raum greifen!
Lehrer haben eine immer größere Verantwortung dafür, dass unsere Kinder lernen, was viele Erwachsene über Bord geworfen haben: Achtung der Meinung des Anderen, auch wenn sie mir nicht gefällt.
Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Die Freiheit der Person ist unverletzlich.
Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten.
Views: 20